
Sich per GPS-Verortung überraschen lassen!
Vermittlungsarbeit zu leisten, für etwas, das gar nicht da ist? Also wirklich gar nicht. Noch nicht einmal irgendein sichtbares Objekt? Das mag zunächst seltsam klingen, dass es aber funktioniert, zeigt dieses Beispiel: Vorbei sind die Bahnfahrten, die endlos lang erscheinen und bei der alle vorbeirauschende Bäume gleich aussehen. Die App „Audioguide für die Strecke Cottbus-Leipzig“ der Deutschen Bahn für Android und iOS liefert Einblicke in historische, kulturelle und geographische Aspekte zu Orten, die sich entlang der Bahnstrecke Cottbus-Leipzig befinden. Die App erklärt beispielsweise, wer hinter dem Namenspatron des berühmten Fürst-Pückler-Eises steckt oder wie die Unterwelt einer Stadt im Muldental aussieht, um hier nur ein wenig der Inhalte preiszugeben. Die Vermittlung funktioniert via GPS-Verortung. Passiert das Smartphone auf der Bahnstrecke (es geht aber auch während der Autofahrt) den entsprechenden vorbeiziehenden Ort, erhält der Nutzer eine Push-Nachricht. Diese wiederum verweist auf die Sehenswürdigkeiten, welche sich in der Nähe befinden. In der App selbst sind dann verschiedene Informationen zu diesen Sehenswürdigkeiten hinterlegt. So können auf der Strecke Cottbus-Leipzig in elf Audiotitel hineingehört werden, die auf vielfältige Art und Weise aufbereitet wurden. Die rund zweistündige Fahrt mit dem Regionalexpress erweist sich so einerseits als unterhaltsame Fahrt, bei der die Umgebung digital kennengelernt werden kann. Andererseits zeigt uns die Funktionsweise der App, wie einfach und spannend Vermittlungsimpulse durch GPS-Verortung mit Pushfunktionen sein können – auch ohne explizit vor den Exponaten zu stehen und vor allem ganz ohne von sich aus Informationen suchen zu müssen. Weiter gilt der Service auch für die anderen beiden Apps der Bahn „Friedrich der Große“ und „Elbe-Elster“. Dafür muss man aber nicht zwangsläufig mit der Bahn unterwegs sein. Auch Autofahrer und Spaziergänger können in Genuss dieser Kulturnews kommen!
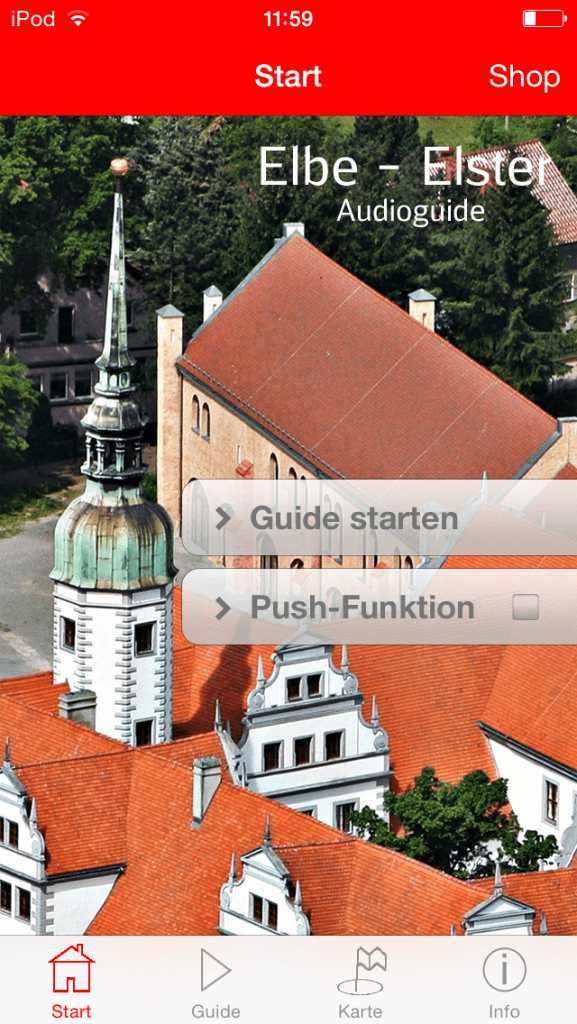
Ein weiteres Beispiel spannender Vermittlung steckt hinter den „Stolpersteinen“ des Künstlers Gunter Demnig. Seit 1997 verlegt er die sogenannten Stolpersteine in den Boden vor ehemaligen Wohnstätten damaliger NS-Opfer. Einerseits hält er so die Erinnerung an die Betroffenen wach und erzählt gleichzeitig ein Stück Geschichte des Hauses bzw. der Wohnstätte. Inzwischen sind auf diese Weise ca. 55.000 Stolpersteine in rund 20 Ländern verlegt worden. In München konnten aber bislang lediglich 24 Stolpersteine auf Privatgrundstücken installiert werden – eine verhältnismäßig geringe Zahl im Vergleich zu anderen Städten. Grund dafür ist ein Beschluss des Stadtrats aus dem Jahre 2004. Mit Rücksichtnahme auf die Israelitische Kultusgemeinde wurde das Verlegen von Stolpersteinen auf öffentlichem Grund verboten. Die Erinnerungen an die NS-Opfer sollen nicht mit Füßen getreten werden, so die damalige Präsidentin Charlotte Knobloch. Die Erinnerung an NS-Opfer sollte allerdings nicht an bürokratischen Fallstricken scheitern. Deshalb wurde die App „Stolpersteine München“ entwickelt. Sie zeigt auf einer Karte die Wohnorte der NS-Opfer an, deren Stolpersteine aufgrund des oben genannten Beschlusses bislang nicht verlegt werden konnten. Aufbereitet mit weiteren Informationen aus dem Stadtarchiv, bietet die App so einmalige Einblicke in die Einzelschicksale und lässt gleichzeitig ihre Geschichte nicht ins Vergessene geraten. Ein besonderer Clou macht die App auf doppelte Weise kurzweilig: Die App öffnet sich automatisch und macht sich via Push-Nachricht bemerkbar, sobald sich der Nutzer an einer der gespeicherten Adresse befindet. Digitale Vermittlung, die durch GPS-Verortung ermöglicht wird. Darauf folgt eine Namensliste von NS-Opfern, die an dieser Adresse zuletzt gemeldet waren. Anhand der Liste kann sich nun der Nutzer individuell über die Lebensgeschichten einzelner Personen informieren. Diese Idee zeigt auf tolle Weise, zeigt, dass Vermittlung im öffentlichen Raum funktionieren kann. Und dies ganz ohne nach den Exponaten zu suchen, geschweige denn, sie überhaupt ohne Weiteres zu entdecken und zu sehen.

Die Ideen zu Vermittlung von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum sind so vielfältig und spannend: Von Portalen über eine ganze Palette an diversen Apps mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich denke, es hat sich herauskristallisiert, dass gerade das Smartphone über besondere Möglichkeiten verfügt, Vermittlung im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Und das wahrscheinlich schneller und lebendiger als zu Hause , vor dem Computer oder in Bibliotheken. Die Informationen sind immer und überall dabei, weil sie quasi in der Hosentasche stecken.
Besonders die letzte App hat es mir besonders angetan. Ich finde es spannend, per Push-Nachricht aufmerksam gemacht zu werden, wenn es etwas Interessantes zu sehen gibt und weitere Informationen zu bekommen. Vor allem dann, wenn etwas explizit nicht zu erkennen ist bzw. es nichts zu erkennen geben kann – wie im Münchner Fall. Der Überraschungseffekt begeistert einfach, macht Spaß die Stadt und die dazugehörende Kultur zu erkunden und übertrifft deshalb meiner Meinung nach die anderen Beispiele. Mit den digitalen Stolpersteinen wurde so ein guter Start gemacht.
Meine Vision der Zukunft
Mein Wunsch für die Zukunft wäre es aber, für die einzelnen Städte die Gesamtheit an Kunst und Kultur in einer App zu sammeln. Nicht nur einzelne Aspekte, wie Skulpturen im öffentlichen Raum, einzelne denkmalgeschützte Häuser, diverse Kirchen, Brunnen, bedeutende großflächige Graffiti-Arbeiten, Museen, Stolpersteine… Alles in einer App! Ausgestattet mit Push-Nachrichten, die aufgrund der GPS-Verortung versendet werden, kann ich mir vorstellen, dass Vermittlung von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum so eine neue Dimension erreicht. Pling! Informationen zu der und der Kirche vorhanden. Pling! Audioguide zu dem und dem Brunnen. Einfach durch eine Stadt zu flanieren und automatisch mit den notwendigen Häppchen aus Kunst und Kultur versorgt zu werden, stelle ich mir entspannt, unkompliziert, unterhaltsam und kurzweilig vor. Vor allem, weil man nicht mehr aktiv danach suchen muss. Weil man nicht wissen muss, wonach man suchen will. Weil man einfach auf eigene Faust die Stadt entdecken kann. Weil man manchmal Dinge entdeckt, die sonst unentdeckt bleiben würden. Man bedenke, mit dem Stadtführer in der Hand muss man sich so nicht mehr als Tourist outen. Einheimische, die ihre Stadt eigentlich wie den Inhalt ihrer Hosentasche kennen, lernen ihre Stadt so noch besser kennen. Und gerade frisch Hergezogene können gleich zu Beginn eine besondere Verbindung zu ihrem neuen Zuhause aufbauen. Will man noch einen Schritt weitergehen, kann man sich überlegen, ob man alles miteinander nicht noch mit einem Spiel kombinieren will. Wer eine bestimmte Anzahl von Stationen entdeckt hat, kann hier oder da noch etwas freischalten oder Extrapunkte sammeln… Doch halt! Das geht hier für den ersten Moment dann doch zu weit. Spiele oder Stadtrallyes in Apps haben es verdient, zu einem anderen Zeitpunkt ausführlicher thematisiert zu werden. Für diesen Augenblick will ich einfach nur bewusst machen, wie viele Möglichkeiten in unseren Smartphones stecken. Und mich begeistert vor allem die Möglichkeit, mit Kunst und Kultur im öffentlichen Raum überrascht zu werden. Dank GPS-Verortung und Push-Nachrichten steckt plötzlich noch so viel mehr in Kunst und Kultur, die sonst gar manches Mal einfach nur so auf der Straße rumliegt.
Teil 1 verpasst?
Verfasserin dieses Beitrags

Carolin Ayasse
Der Beitrag Teil 2: Auf der Suche nach Kunst und Kultur? erschien zuerst auf Pausanio GmbH & Co.KG.