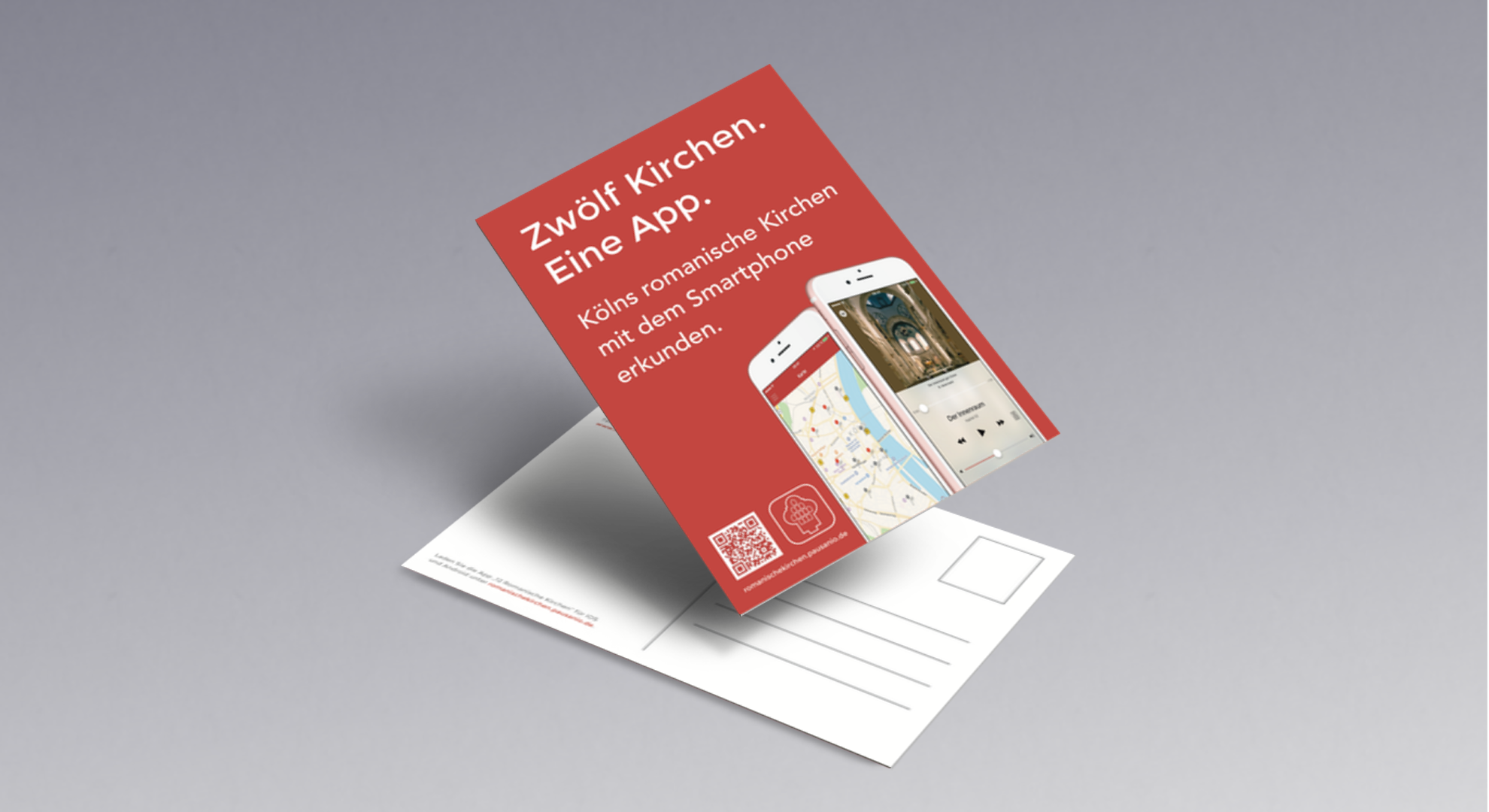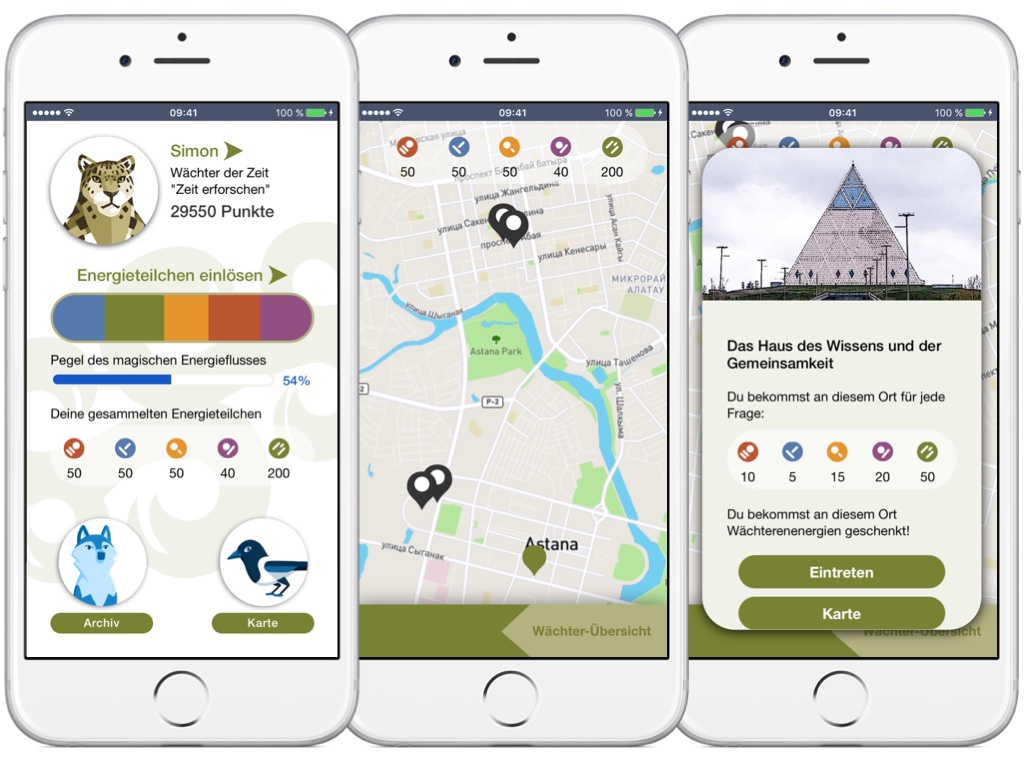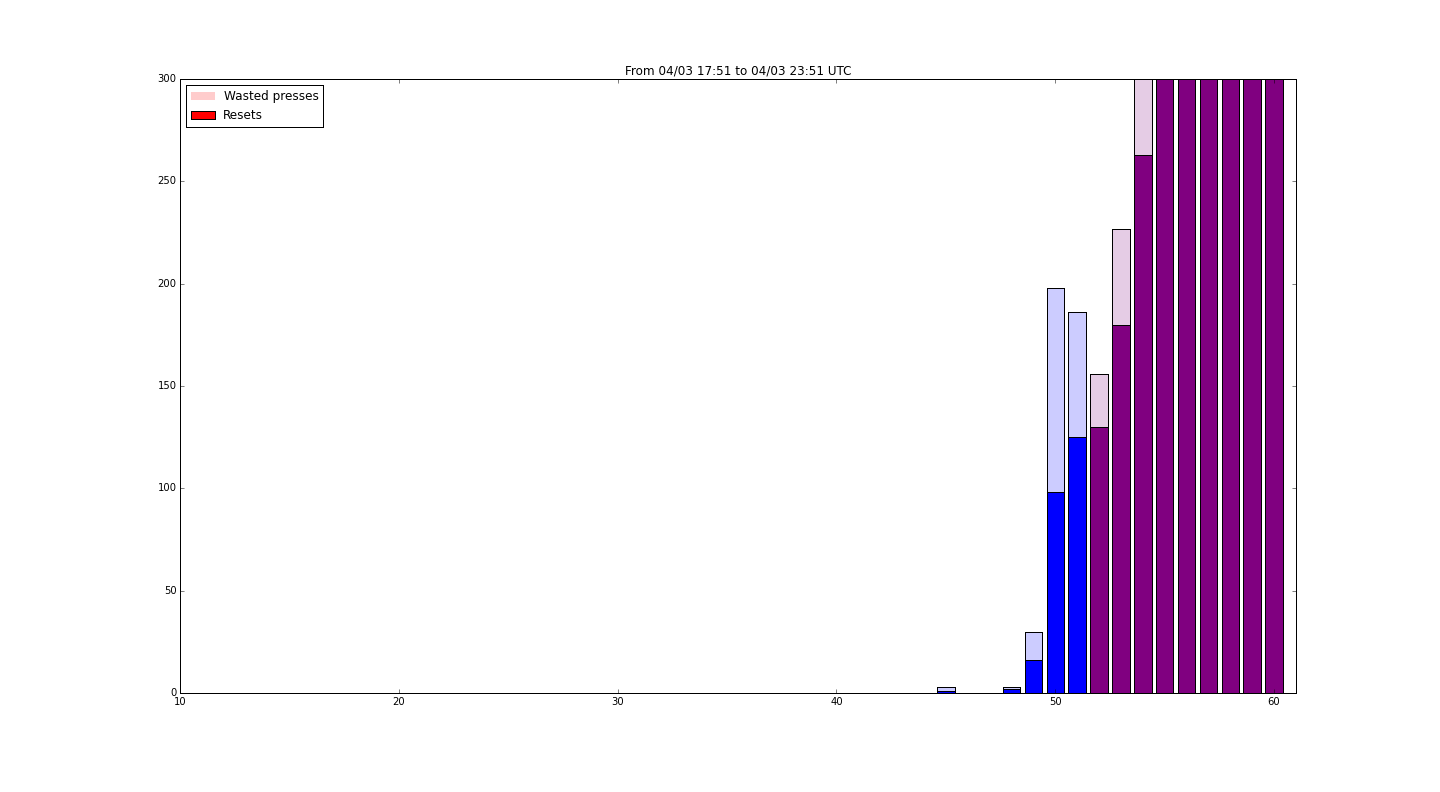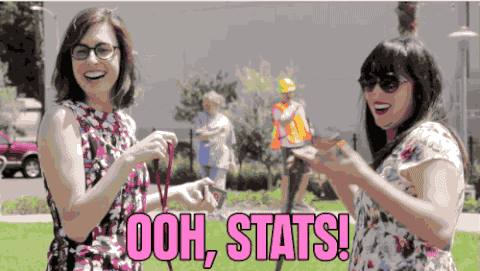Mehrmals die Woche bloggte Marta, das Museum für zeitgenössische Kunst in Herford. Mehrmals die Woche erschienen Artikel unterschiedlichster Art von verschiedenen Autoren, bis damit plötzlich Ende Oktober Schluss sein sollte. #Martabrichtaus! Aber nur für einen Monat, zum Glück! Denn das gesamte Museumsteam wollte sich die Zeit nehmen, um ein bisschen Abstand zum Blog zu gewinnen. Die Idee dahinter: Die Inhalte und die Intention hinter dem Blog sollten neu überdacht und die alte Strategie neu fokussiert werden. Seit dem 2. Dezember ist Marta nun zurück. Ein Schritt, der Mut beweist und doch der richtige zu sein scheint!
Der Museumsblog: Einer von vielen?
Der Marta-Blog ist nur einer von derzeit 95 aktiven Museumsblogs in Deutschland, wie der Blogroll von KulturMuseumTalk zeigt. Eine recht geringe Zahl, wie Tanja Praske in ihrem Kommentar bei MUSERMEKU bemerkt. Denn obwohl wir allerorts den digitalen Wandel sehen, scheint das die Zahl der Museumsblogs nicht sonderlich zu beeinflussen. Hatte Praske bereits im Jahr 2013 65 Blogs gezählt, so sind es heute – drei Jahre später – nur 30 mehr. Eine winzige Ausbeute, wenn man bedenkt, dass es mehr als 6.500 museale Institutionen in Deutschland gibt. Dabei ist es nicht nur bedauerlich, dass sich noch immer erst wenige Museen in die Sozialen Netzwerke trauen. Es ist vor allem deswegen bedauerlich, weil gerade Blogs viele Chancen und Nutzen bereithalten.
Was bringt ein Blog eigentlich?
Wie auf Facebook, Twitter und Co. ist es auf einem Blog möglich, Informationen zu streuen und so mit Lesern durch die Kommentarfunktion ins Gespräch zu kommen und mit ihnen zu diskutieren. Die Kernarbeit eines Blogs ist es allerdings, eigene Inhalte zu publizieren. Und zwar solche, die NICHT einer bestimmten Zeichenzahl unterworfen sein müssen, um entweder überhaupt gepostet oder von den Nutzern registriert zu werden. Im Gegensatz dazu bietet der Blog genügend Raum, um dort ausführlich Stellung zu beziehen, Museumsinhalte bzw. -einblicke zu zeigen und Wissensvermittlung zu betreiben. Das ist der eigentliche Mehrwert von Blogs, der von anderen Kanälen in diesem Umfang nicht geleistet werden kann. Oder haben Sie schon einmal eine gute Bildbeschreibung in max. 140 Zeichen gelesen? Außerdem können durch die dort generierten Inhalte wiederum andere Social-Media-Kanäle gespeist werden. Zusammengefasst ist der Blog demnach Teil einer ganzheitlich gedachten Social-Media-Strategie, die Hand in Hand mit anderen Kanälen geht und deshalb nicht vernachlässigt werden sollte.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt!
Um diese Vorteile nachhaltig zu verfolgen ist eine Strategie unumgänglich. Diesen Aspekt führt uns auch die Abschaltung des Marta-Blogs deutlich vor Augen. Teil der Strategie muss es nämlich auch sein, dass funktionierende Plattformen von Zeit zu Zeit überdacht und die Strategie neu ausgerichtet werden muss. Schließlich nagt der Zahn der Zeit an allem und bringt laufende Veränderungen mit sich. Nicht nur, dass technische Neuerungen wie responsive Websites Veränderungen der Plattform bedürfen. Auch Mitarbeitende kommen und gehen – und geben der Institution damit eine andere und vielleicht neue Ausrichtung. Der Blog als Spiegel der Institution darf demnach nicht statisch sein, sondern muss sich im Gegenteil anpassen. Manchmal braucht es einfach einen „Content-Relaunch“, resümiert der künstlerische Direktor des Marta Herford Roland Nachtigäller.
Wir finden: Ein Blog lohnt sich!
Wir finden, dass der Blog das Herzstück einer digitalen Strategie ist, dessen sich viel mehr Museen bedienen sollten. Aber natürlich dient es der Social-Media-Strategie nicht, einfach nur einen Blog aufzusetzen, damit es einen gibt. Ein Blog bedarf eines Konzepts sowie der regelmäßigen Pflege. Nur dann ist er gewinnbringend und macht Spaß.
Diese Aspekte hat das Marta Herford für sich erkannt und sich entschlossen, die Strategie zu überholen. Ein Schritt, der Mut beweist, sich aber lohnt. Und deshalb wollen wir das Marta Herford herzlich zum Relaunch beglückwünschen!
Verfasserin dieses Beitrags

Carolin Ayasse
Der Beitrag Blog geht immer!? Gedanken zur Notwendigkeit von Blogs erschien zuerst auf Pausanio GmbH & Co.KG.